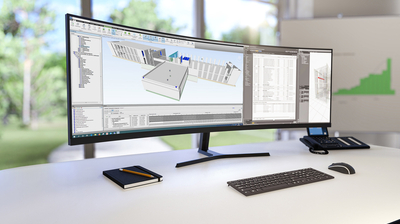Dr. Nick Lindschulte, Sohn von Firmengründer Heinrich Lindschulte, hat eine besondere Beziehung zur Lindschulte Ingenieurgesellschaft. Der gebürtige Nordhorner ist heute Projektleiter Tragwerksplanung und erzählt im Jubiläumsblog von seinem persönlichen Weg und den Besonderheiten „seiner“ Branche.
Sie sind mit dem Unternehmen Lindschulte aufgewachsen. War es schon immer Ihr Plan, hier später einmal einzusteigen?
Nein, ich habe nach der Schule überlegt zu studieren und als erstes die Informatik im Auge gehabt, weil ich hier im Unternehmen schon für Informatikfelder zuständig war. Ich habe z.B. einige Schritte der digitalen Visualisierung betreut. Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Informatik habe ich gemerkt, doch eine fachbezogene Richtung einschlagen zu wollen. So kam es dann dazu, dass die Bauinformatik in den Fokus rückte und ich mich für den Studiengang Bauingenieurwesen in Hannover entschieden habe, weil hier die Verbindung von Ingenieurwissen und Informatik gegeben war. Während des Studiums hat mir der klassische Baubereich, insbesondere Statik und Mechanik, allerdings so viel Spaß gemacht, dass ich am Schluss doch konstruktiv vertieft habe.
Wie ging es dann weiter?
2005 war die Situation im Baubereich nicht ganz einfach, ich habe meine ersten Erfahrungen dann auch hier im Unternehmen gesammelt. Über einen Kontakt ergab sich eineinhalb Jahre später eine Promotionsstelle in Hannover – und das fand ich einfach spannend. Ich hatte früh Kontakt zum Professor und das passte von beiden Seiten. An einem Institut für Baustoffe habe ich zum neuen Hochleistungsbeton UHPC (ultrahigh performance concrete) in konstruktiver und materialgerechter Anwendung promoviert. Somit konnte ich die wertvollen betontechnologischen Erkenntnisse mit dem Massivbau und dem Stahlbau verbinden.
Nach meiner Promotion war mein Vater bereits bei Lindschulte ausgestiegen, aber ich wollte gern ins Unternehmen zurück. Wir wurden uns schnell einig und nun bin ich seit 2013 im Unternehmen.
Wie sehen Ihre Aufgaben heute aus?
Mein Hauptschwerpunkt ist der Brückeningenieurbau, also alles rund um die Bemessungs- und Konstruktionsfragen. Eine Brücke wird berechnet unter verschiedenen Fragestellungen. Es gibt verschiedene Brückenarten, Materialien, Anforderungen und danach müssen wir die Brücke auslegen. Wir führen dann eine ganze Reihe von Nachweisformaten durch, um zu zeigen, dass die Brücke verschiedene Rahmenbedingungen und Sicherheitsanforderungen einhält.
Ich mache das aber auch sehr umfangreich für Hochbaukonstruktion. Im Prinzip beschäftige ich mich mit den Themen Konstruktion, Bemessung und Statik in allen Facetten. Es geht um neue, aber auch um bestehende Strukturen, also um Instandsetzung. Wenn wir Gebäude oder andere Strukturen so wiederherrichten, wie sie waren, sprechen wir von „reiner Instandsetzung“. Manchmal verändern wir aber zum Beispiel die Funktion, aus einer Radwegbrücke wird eine Straßenbrücke. Dann muss die Struktur verstärkt werden, eine „einfache“ Wiederherstellung reicht nicht aus. Gerade in Fragen bei Bestandsbauwerken spielt das Material eine große Rolle: Was kann der Baustoff, was kann er nicht? Bei der Bewertung kommt mir auch mein eher ungewöhnlicher Werdegang zugute, die Promotion hat sich hier definitiv gelohnt.
Die vielen Perspektiven machen meinen Beruf so abwechslungsreich. Was zeichnet Ihr Tätigkeitsfeld sonst noch aus?
Eine Besonderheit ist definitiv die Aktualität und die anhaltenden Diskussionen in der Presse rund um das Thema Sicherheit. Als in den vergangenen Jahren in Italien die tragischen Brückeneinstürze geschehen sind, wurde auch hierzulande viel Besorgnis geäußert. Ich hatte hier die Möglichkeit, den Sachverhalt fundiert beurteilen zu können und zumindest für Deutschland den Schluss zu ziehen, dass es hier aufgrund der gesamten Konzeption aus Konstruktionsanforderungen und stetiger Überwachung keinen Grund zur Panik gibt.
An welchen Innovationen wird im Bereich Betoninstandsetzung gerade geforscht und welche Fragen der Zukunft müssen noch beantwortet werden?
Die Materialien sind immer noch ein topaktuelles Thema. Das Hochleistungsmaterial, das ich in der Promotion behandelt habe, wird auch in Zukunft Anwendung finden. Leider haben es Innovationen in unserer Branche nicht immer ganz leicht, sich durchzusetzen. Das gilt eigentlich für die gesamte Baubeteiligung. Mit diesem Eindruck bin ich auch nicht allein; es gibt Professorenstatements, die das widergeben. In allen Detailfragen gibt es umfangreiche Regelungen, die die empfundene „Regelungswut“ der EU sogar noch in den Schatten stellen können. Gerade im öffentlichen Bau, also beispielsweise bei Brücken, vergibt die öffentliche Hand vorrangig nach dem Kriterium „Einhalten von Normen“, damit die Angriffsfläche auf diesem Gebiet so klein wie möglich bleibt. Dazu trägt die mediale Entwicklung, wie wir sie derzeit erleben sicherlich auch bei.
Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen: Im Brückenbau gibt es eine Standardbauweise unter dem Begriff „Spannbeton“. Die ist in den 50er bis 60er Jahren entwickelt worden. Mit dieser Bauweise kann man deutlich schlanker bauen, benötigt also weniger Material, weniger Zeit und insgesamt weniger Ressourcen. Damals war das Verfahren hoch modern und „nagelneu“, mittlerweile ist es die Standardbauweise. So eine abweichende Bauart heute durchzusetzen ist nur schwer vorstellbar.
Dennoch ist die Forschung in Deutschland sehr aktiv, man versucht zunehmend schlanker zu konstruieren. UHPC oder auch Systeme mit Kunststoffcarbon sind durchaus zukunftsweisend. Natürlich müssen die hohen Sicherheitsstandards gewährleistet werden. Diese festigkeitsgesteigerten Materialen sind von Natur aus wesentlich spröder im Bruchverhalten und müssen daher für die sicherheitsbasierten Anforderungen im Baubereich erst anwendbar gemacht werden. Alles Neue ist ein Risiko, das will nicht jeder gerne eingehen. Wenn dann doch was passiert, schlägt die Welle brutal auf die Verantwortlichen ein. Eine überzogene Vorsicht fördert aber nicht gerade die Innovation.
Gerade in den sozialen Medien gibt es immer wieder sehr viele unreflektierte Reaktionen. Deswegen ist eine Kommunikation über die reine Faktenlage notwendig. Deutschland forscht insgesamt sehr erfolgreich. Es wird sehr „fein“ kommuniziert und publiziert, zum Beispiel in Fachzeitschriften, die auch weit über die Uni hinaus relevant sind. Das ist aber eine Kommunikationsebene, die in den eher schnellen und oberflächlichen sozialen Medien keine Beachtung finden. Man versucht Pilotprojekte zu initiieren und findet dafür auch interessierte Baufirmen. Obwohl in der Autoindustrie Sicherheitsfragen ebenfalls eine große Rolle spielen, ist diese Branche deutlich schneller als der Baubereich. Wenn wir heute eine Brücke in Betrieb nehmen, dann ist die allerdings darauf ausgelegt, 2119 erst wieder neu gebaut zu werden. Das gilt für die Autoindustrie wohl kaum. So schnell wird sich daran auch nichts ändern.
Welche Projekte sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und gibt es andererseits Projekte, die Sie im Laufe Ihrer Karriere gern noch realisieren würden?
Das Spannendste ist für mich immer das, was statisch anspruchsvoll ist. Da sind verschiedene Bauweisen, die ich bereits habe machen dürfen: ein vorgespannter Hohlkasten oder Stahlverbund Brückenbau, das waren besonders interessante Brückenbauwerke. Man muss sich aber auch vor Augen halten, dass große Bauvorhaben gern mal zehn Jahre oder länger dauern und wir Ingenieure uns dann über einen sehr langen Zeitraum mit diesem einen Projekt auseinandersetzen. Auch muss ich realistisch bleiben, was solche Großprojekte angeht. Grundsätzlich gilt deswegen, dass auch kleinere Projekte sehr begeistern können, wenn Sie besonders ausgestaltet sind.
Ein eher außergewöhnliches Projekt habe ich zum Beispiel mit einem Kollegen aus Münster in Gronau bearbeitet. Da ging es um eine große Statue von Udo Lindenberg, der dort geboren ist. Wir haben die Figur untersucht — da sind wir dann auch wieder bei Materialfragen — denn niemand wusste, woraus dieses Werk bestand. Das ist ja in Deutschland eigentlich undenkbar, aber ein Künstler außerhalb Deutschlands hatte die Skulptur erstellt ohne dafür technische Unterlagen mitzuliefern. Das war dann auf anderer Ebene ein spannendes Projekt und es gefällt mir, dass wir uns auch solchen Herausforderungen stellen dürfen.
Eine abschließende Frage: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Branche?
Planung wird komplexer und es gibt in meinem Empfinden immer mehr Reibungspunkte. Oft wird noch im sehr späten Planungs- und teilweise schon Ausführungsprozess umgeplant, Ansprüche verändern sich, der öffentliche Druck wächst unter Umständen, außerdem muss alles in den Rahmen der Bürokratie eingepasst werden. Das Ganze kombiniert mit einem hohen Zeitdruck Deshalb wünsche ich mir, dass der Wert von guter Planung noch mehr erkannt wird und sich die Branche in den nächsten Jahren weiterentwickelt.